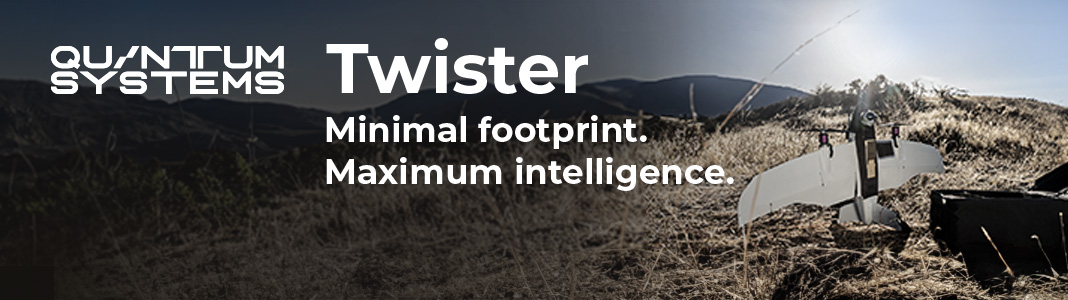Das nordatlantische Verteidigungsbündnis NATO sucht im Rahmen eines sogenannten „Innovation Challenge“-Wettbewerbs nach Lösungen zur Abwehr von Gleitbomben. Dies hat das in Norfolk ansässige Alliierte Transformations-Kommando (NATO ACT) am 5. Februar 2025 auf seiner Internetpräsenz veröffentlicht. Bis zum 13. März 2025 können Interessenten Teilnehmer ihre Entwürfe einreichen.
Der Einsatz von sogenannten Gleitbomben stellt laut der Mitteilung der NATO eine weiterhin hohe Gefahr für die ukrainischen Streitkräfte und auch die Zivilbevölkerung dar. Deswegen ist es Ziel des Wettbewerbs, Lösungen für die Detektion, das Abfangen und Zerstörung solcher Waffen, aber auch ihrer Trägersysteme zu untersuchen. Dabei können die einzureichenden Wettbewerbsbeiträge von verfügbaren und in Fertigung befindlichen Lösungen oder deren Abwandlungen bis hin zu Ansätzen in der frühen Konzeptphase reichen. Auch sind die Teilnehmer frei in der Ausgestaltung und könne sich auf Teilaspekte des Problems, wie etwa der Härtung von Infrastruktur zur Steigerung der Resilienz oder auf Maßnahmen im Cyberraum, etwa um den Einsatz der Trägersysteme zu stören oder zu unterbinden, konzentrieren.
Die seit 2017 stattfindende NATO Innovation Challenge untersucht erfahrungsgemäß Fragestellungen, welche mit aktuellen Bedrohungen in Verbindung stehen. So wurden 2024 Wettbewerbe zur automatisierten Räumung von Minenfeldern durch unbemannte Systeme, bzw. zur Härtung von Kommunikationssystemen gegen die Einwirkung feindlicher elektronischer Kriegsführung abgehalten. Durch den an einen breiten Teilnehmerkreis aus allen Mitgliedsländern des Bündnisses gerichteten Aufruf sollen innovative und idealerweise sogar marktverfügbare Lösungsansätze identifiziert und so im besten Fall schneller für eine mögliche Beschaffung verfügbar gemacht werden.
Russischer Gleitbombeneinsatz in der Ukraine
Unter dem Oberbegriff Gleitbombe versteht man im Ukrainekrieg den Einsatz unterschiedlicher russischer Lenkbomben und mit einem Rüstsatz versehene Freifallbomben. Neben den ebenfalls verfügbaren als Gleit- und Lenkbombe entwickelten Typen wie der UPAB-1500B kommen seit 2023 vornehmlich mit dem sogenannten Einheitliches Gleit- und Korrekturmodul (UMPK) nachgerüstete, ehemalige Freifallbomben unterschiedlichen Typs zum Einsatz. So können neben FAB-Spreng-/Splitterbomben mit unterschiedlicher Masse auch Streu- und Aerosolbomben nachgerüstet werden. Konzeptionell ähnelt das UMPK-System stark den US-amerikanischen Joint Direct Attack Munition (JDAM).
Die Steuerung erfolgt über das in den Nachrüstsatz integrierte Kometa-M Satellitennavigationssystem, welches gegen Störmaßnahmen gehärtet ist. Zudem ist für den Fall eines Ausfalls der Satellitennavigation ein Trägheitsnavigationssystem integriert. Für die Kurskorrektur sind die nach dem Abwurf ausklappenden Flügel mit zwei elektronisch betriebenen Steuerflächen versehen. Die Energieversorgung übernehmen zwei Thermalbatterien, wodurch der Rüstsatz eine hohe Lagerdauer aufweist. Zur Verbesserung der aerodynamischen Eigenschaften wird die Spitze der Bombe zudem mit einer strömungsgünstig geformten Haube versehen. Die so nachgerüsteten Systeme haben je nach Bombentyp effektive Reichweiten von 35 bis 40 km im Ukrainekrieg nachgewiesenen.
Konzepte zur Abwehr
Der erfolgreiche Einsatz der Gleitbomben seit 2023 hat bereits früh Analysten auf den Plan gerufen, um die mögliche Abwehr der Systeme zu betrachten. Beobachter des Konfliktes sind sich einig, dass die Bekämpfung der Trägersysteme ein Schwerpunkt der Abwehr sein muss. Neben der Stärkung insbesondere der weitreichenden Flugabwehr hatte man sich auch durch die Einführung der F-16 Jagdflugzeuge eine Verbesserung der Situation erhofft. Zudem ist der Einsatz von ukrainischen Einwegdrohnen gegen in der strategischen Tiefe befindliche, russische Flugplätze ebenfalls unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten. Die Nutzung von Mitteln des elektronischen Kampfes ist ein weiterer Ansatzpunkt. Durch die Störungen der GLONASS/GPS-Satellitennavigation kann die Präzision der Bombe stark eingeschränkt werden.
Der aktuelle Wettbewerb der NATO geht jedoch einen Schritt weiter. Neben den erwähnten Maßnahmen zur Störung oder Bekämpfung von Trägersystemen werden auch Konzepte und Lösungen gesucht, um etwa sie Bombe im Zielanflug zu bekämpfen. Aber auch Maßnahmen im Cyberraum oder solche, die sich gegen die Herstellung der Systeme und ihre für die Fertigung benötigten Lieferketten richten, sollen potenziell untersucht werden.
Kristóf Nagy