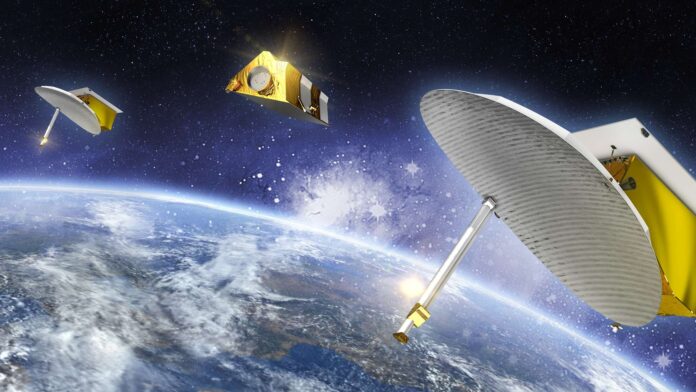Eigentlich sollte die Satellitenkonstellation des Projektes SARah (Synthetic Aperture Radar altitude high) zur Gewinnung von Aufklärungsdaten bereits im vergangenen Jahr in Betrieb gehen. Zumindest hatte dies die Bundeswehr angekündigt. Das ist jedoch noch nicht geschehen, denn die zwei Bildaufklärungssatelliten der Firma OHB auf Basis der „Synthetic Aperture Radar-Reflektorantennen“-Technologie sind offensichtlich weiterhin nicht funktionstüchtig. Presseberichten zufolge funktioniert der Ausfahrmechanismus für die Reflektor-Antenne der Satelliten nicht. Lediglich der dritte von Airbus gelieferte SARah-Satellit auf Basis der „Synthetic Aperture Radar-Phased Array“-Technologie mit Strahlschwenkung funkt seit 2023 seine Daten in hoher Qualität zur Erde.
Wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums hartpunkt auf Nachfrage mitteilte, hat das BMVg aufgrund des mit OHB geschlossenen Vertrages weiterhin Anspruch auf die Bereitstellung von zwei funktionstüchtigen Satelliten. Seinen Worten zufolge gibt es zwei Lösungen: Entweder der Auftragnehmer nehme die Satelliten in Betrieb oder, wenn dies nicht möglich sei, baue die Satelliten nach und schieße sie in den Weltraum.
Da sich die beiden Satelliten seit vorletztem Jahr im All befinden und die Versuche, die Antennen auszuklappen, offenbar nicht erfolgreich waren, dürfte die zweite Option immer wahrscheinlicher werden. Insider gehen deshalb davon aus, dass OHB die Satelliten neu bauen wird. Eine Sprecherin des Unternehmens wollte dazu auf Nachfrage aus vertraglichen Gründen keine Auskunft geben.
Im Jahresbericht des Unternehmens, der vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde, heißt es mit Bezug auf das Vorhaben SARah, bei dem OHB der Hauptauftragnehmer ist: „Der Phased-Array-Satellit wurde bereits im Jahr 2023 in Dienst gestellt. Die beiden von OHB hergestellten Satelliten befinden sich in einer erweiterten Phase der Inbetriebnahme.“
Und wenige Abschnitte danach: „Bereits seit Anfang des Jahres 2018 sind die ersten SARah-Bodenanlagen operativ und haben auch im Geschäftsjahr 2024 den Betrieb der SAR-Lupe-Satelliten geleistet.“ Die Satellitenbodensysteme für SARah sind demnach inzwischen vollständig in Betrieb. Die Abnahme könne jedoch erst erfolgen, „wenn die erweiterte Phase der Inbetriebnahme weiterer SARah-Satelliten abgeschlossen ist“.
In der Pressemitteilung zum Jahresbericht schreibt OHB, dass das Ergebnis des Geschäftsjahres 2024 von einer projektbezogenen Risikorückstellung geprägt sei, ohne jedoch auf Details einzugehen. Beobachter glauben darin einen Hinweis auf den geplanten Nachbau herauszulesen.
Im hinteren Teil des Geschäftsberichtes findet sich dann unter der Rubrik Finanzrisikomanagement eine weitere aufschlussreiche Passage: „Im Lichte der Einmalbelastung aus SARah hat sich die Gesellschaft die Zustimmung der finanzierenden Banken dazu eingeholt, dass dieser Ergebniseffekt für Zwecke der Berechnung der Finanzkennzahlen für den 31. Dezember 2024 bis inkl. 30. September 2025 herausgerechnet („adjusted“) werden darf.“ Letztendlich ist aber auch dies noch kein Nachweis, dass OHB die Satelliten tatsächlich nachbauen will. Schließlich ist nicht ausgeschlossen, dass die Funktionsfähigkeit doch noch ganz oder teilweise hergestellt wird. So kursierten zuletzt Gerüchte, wonach einer der beiden Satelliten eine teilweise Funktionsfähigkeit erreicht haben könnte. Auch dazu wollte sich die OHB-Sprecherin nicht äußern. Es bleibt also abzuwarten, wie es nun mit SARah weitergeht.
Neben der Gewinnung von Informationen durch selbst betriebene Satelliten will die Bundeswehr offensichtlich als Ergänzung auch auf kommerzielle Radardaten zurückgreifen. Dem Vernehmen nach haben die Streitkräfte deshalb bei mehreren Anbietern eine entsprechende Anfrage gestellt, um komplementäre Daten zu erhalten.
Während beim lange vor dem Ukraine-Krieg gestarteten Projekt SARah relativ große Satelliten zum Einsatz kommen, scheint die Tendenz mittlerweile zu kleineren Trabanten im Medium und Low Earth Orbit (MEO/LEO) zu gehen. Diese sind billiger und lassen sich womöglich bald mit kleinen Raketen (Microlauncher), wie sie Isar Aerospace kürzlich auf dem norwegischen Platz Andøya getestet hat, vom europäischen Boden aus starten. Alternativ könnten kleinere Exemplare auch von wiederverwendbaren Weltraumflugzeugen, wie sie gerade bei POLARIS in Bremen entwickelt werden, in den Orbit transportiert werden.
Die europäische Verbringungsfähigkeit würde im Kriegsfall die Resilienz stärken, wenn große Satelliten vom Gegner beschädigt oder zerstört werden. Die kleinen LEO-Satelliten könnten dann im Rahmen des Konzeptes „Responsive Space“ bei Bedarf kurzfristig ins All nachgeschossen werden.
Wie das Handelsblatt heute berichtet, soll die Bundeswehr mittlerweile sogar den Aufbau einer eigenen Satellitenkonstellation bis 2029 planen. Brancheninsidern zufolge wolle Deutschland dabei auf heimische Firmen setzen, schreibt die Zeitung. Ein Sprecher des BMVg konnte dies hartpunkt so nicht bestätigen. Man betrachte mehrere Optionen für Multi-Orbit-Fähigkeiten, dazu gehöre auch die in Vorbereitung befindliche europäische Satellitenkonstellation Iris2, teilte er auf Nachfrage mit.
Bedarf für eine LEO-Konstellation dürfte die Bundeswehr im beschriebenen Bereich der Erdaufklärung aber auch bei Kommunikation und Signalaufklärung haben. Dabei könnte es sich für die Bundesrepublik allerdings anbieten, mit engen Partnern wie Norwegen oder Großbritannien gemeinsame Satellitenkonstellationen aufzubauen. So hat das britische Verteidigungsministerium erst zu Jahresbeginn Airbus im Rahmen des Vorhabens „Oberon“ für 127 Millionen Pfund damit beauftragt, zwei Satelliten mit Synthetic Aperture Radar (SAR) für Aufklärungszwecke zu liefern. Laut dem Ministerium ist der Start der jeweils 400 kg schweren Satelliten, die Teil einer Konstellation werden sollen, für 2027 vorgesehen. Da Berlin und London im Rahmen des im Herbst vergangenen Jahres geschlossenen Trinity-House-Abkommens eine engere Verteidigungskooperation angekündigt haben, könnte die deutsche Beteiligung an der Satellitenkonstellation eine interessante Option darstellen.
Sollte die Bundeswehr – wie vom Handelsblatt berichtet – tatsächlich Geld für den Aufbau einer Satellitenkonstellation erhalten, könnte dies für die heimische Raumfahrtbranche positive Auswirkungen haben. Bisher sind hierzulande insbesondere OHB und Airbus Defence and Space für ihre Expertise im Bau von Satelliten bekannt. So hat Airbus nicht nur den genannten SARah-Satelliten entwickelt. Der Konzern baut bereits seit Jahren die Kommunikationssatelliten für OneWeb, dem von Eutelsat betriebenen europäischen Pendant zum amerikanischen Starlink.
Überdies hat sich zuletzt der Rüstungskonzern Rheinmetall in Position gebracht. Wie Rheinmetall-CEO Armin Papperger im März während einer Analystenkonferenz sagte, denkt das Unternehmen daran, Satelliten zu bauen. Rheinmetall ist bereits an ICEYE beteiligt, einem finnischen Satelliten-Produzenten und Betreiber einer Satellitenkonstellation. Papperger sagte damals, man befinde sich mit der Regierung in Gesprächen, sich als „Satellite House“ zu etablieren. Die Idee sei, mindestens sechs LEO-Satelliten zu haben und dann jeweils in den kommenden Jahren zwischen sechs bis zehn Satelliten in Deutschland unter Lizenz zu bauen.
Wie ein Rheinmetall-Sprecher kürzlich auf Nachfrage dazu mitteilte, ist der Konzern grundsätzlich daran interessiert, AIT-Kapazitäten (Assembly, Integration, Testing) für Satelliten in Deutschland aufzubauen. Bisher handele es sich jedoch nur um Überlegungen. „Konkrete Entscheidungen hängen in hohem Maße vom Kunden ab, insbesondere von der Anzahl der geplanten Satelliten“, so der Sprecher.
Dagegen befindet sich das klassische Geschäft mit Großsatelliten in Europa in der Krise. So will Airbus in diesem Segment eine große Anzahl von Arbeitsplätzen abbauen, offenbar in Vorbereitung auf die Verhandlung befindliche Verschmelzung der eigenen Satellitensparte mit denen von Thales und Leonardo.
Lars Hoffmann