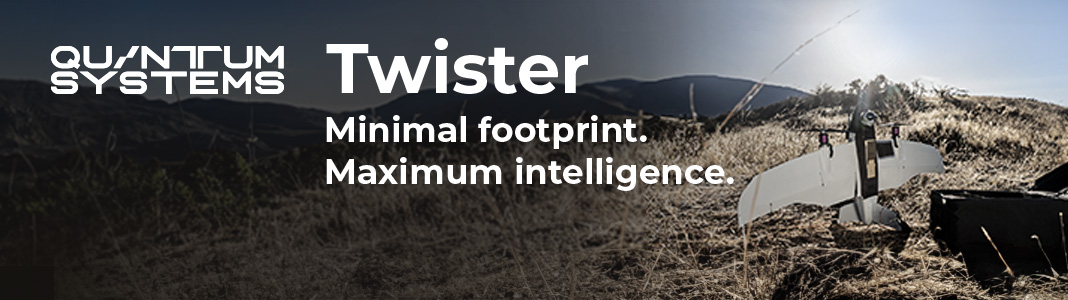Wie sollte die Ukraine ihre zukünftige Abschreckungsstrategie gestalten, um einen Folgekrieg mit Russland zu verhindern? Einige mögen argumentieren, dass es verfrüht ist, diese Frage zu stellen, solange die russische Invasion, die im Februar 2022 begann, andauert und kein Ende in Sicht ist.
Zwar ist es wichtig, sich auf die Führung des gegenwärtigen Krieges zu konzentrieren, doch gibt es zwei Gründe, warum es notwendig ist, an die Zukunft zu denken: Erstens kann sich die Ukraine nicht den Luxus leisten, sich ausschließlich auf die Gegenwart zu fokussieren. Es wäre wenig gewonnen, eine Niederlage im Hier und Jetzt abzuwenden, wenn man auf eine zukünftige Konfrontation mit Russland unvorbereitet wäre.
Zweitens haben mehrere Analysten bereits ihre Ansichten darüber dargelegt, was die Ukraine braucht, um einen dauerhaften Frieden zu sichern. Nicht alle diese Analysen sind konzeptionell oder empirisch fundiert, so dass es wichtig ist, ihnen dort zu widersprechen, wo es nötig ist.
Ein gutes Beispiel ist der kürzlich in Foreign Affairs erschienene Artikel von Samuel Charap, in dem er einen Fahrplan für einen Waffenstillstand und Frieden in der Ukraine skizziert. Im Folgenden konzentriert sich dieser Beitrag auf zwei zusammenhängende Argumente aus Charaps Artikel, die konzeptionell und empirisch fehlerhaft sind: (1) dass die Ukraine defensiven Fähigkeiten gegenüber offensiven den Vorzug geben sollte, um eine „stabile“ Abschreckungsbeziehung zu Russland aufzubauen, und (2) dass eine stabile Abschreckungsbeziehung, also eine, die Eskalationsrisiken gering hält, zwangsläufig die beste ist.
Abschreckungsstrategien
Auf der konzeptionellen Seite gibt es zwei Probleme mit dem Argument, dass eine stabile Abschreckung defensive Fähigkeiten erfordert und die Ukraine daher nur mit defensiven Waffensystemen ausgestattet werden sollte.
Erstens sind Abschreckungsstrategien per definitionem defensiv, da sie darauf abzielen, einen bestimmten Status quo aufrechtzuerhalten – sei es in Bezug auf die Dynamik von Bündnissen, territoriale Besitzverhältnisse oder das relative Gleichgewicht der Kräfte in einer bestimmten Zweierbeziehung.
Natürlich sagt diese Definition wenig darüber aus, ob der Status quo gerecht ist oder wie er erreicht wurde. Außerdem kann ein Akteur einen bestimmten Status quo mit offensiven Ambitionen verteidigen. In solchen Fällen dienen Abschreckungsstrategien als Sprungbrett für künftige Offensivaktionen (man denke nur daran, dass Russland die 2014 annektierte und bis 2022 verteidigte Krim als Aufmarschgebiet für seine groß angelegte Invasion im Jahr 2022 nutzte). Dennoch bleibt die Abschreckung per Definition eine defensive Strategie, da sie nicht den Anspruch hat den Status quo zu revidieren.
Selbst wenn man sich der Idee von inhärent offensiven und defensiven Waffen anschließt – eine Kategorisierung, die oft und nach Auffassung des Autors zurecht abgelehnt wird –, sollte dies keine Rolle spielen, wenn das Ziel darin besteht, die Ukraine in die Lage zu versetzen, eine wirksame Abschreckungsstrategie gegen Russland zu verfolgen, die per Definition defensiv ausgerichtet sein wird. Mit anderen Worten: Wenn das Ziel darin besteht, der Ukraine die Mittel für eine wirksame Abschreckung Russlands an die Hand zu geben, sollte die Einstufung bestimmter Waffensysteme als Offensiv- oder Defensivwaffen irrelevant sein, solange sie zur Abschreckung Russlands beitragen.
Zweitens, obwohl Charap durchaus Recht darin hat zu argumentieren, dass einige Abschreckungsstrategien besser sind als andere, machen er und andere Analysten den Fehler, gute Abschreckungsstrategien mit solchen gleichzusetzen, die das Eskalationsrisiko minimieren, während sie Strategien, die Eskalationsrisiken schaffen, als grundsätzlich schlecht einstufen. Doch diese Einteilung ist zu simpel.
Zwei Beispiele verdeutlichen dies
Betrachten wir erstens die langjährige, mindestens bis in die 1960er Jahre zurückreichende Debatte in den USA über den Verzicht auf eine nukleare Erstschlagskapazität. Ein solcher Schritt hätte die Stabilität der Abschreckung zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten – oder jetzt zwischen den Vereinigten Staaten und Russland – erheblich verbessern können, wäre aber auf Kosten der US-Verbündeten gegangen, die eine glaubwürdige US-Erstschlagskapazität immer als wesentlich für ihre eigenen Interessen und ihre Sicherheit angesehen haben und andernfalls die Zuverlässigkeit der erweiterten nuklearen Abschreckung der USA in Frage gestellt hätten.
Zweitens sollte man bedenken, dass der Westen der Stabilität der NATO-Russland-Abschreckung in seiner Ukraine-Politik seit mindestens 2014 Vorrang einräumt. Zweifellos haben das Nachgeben gegenüber russischen Forderungen und die Verhängung nur milder Sanktionen die Eskalationsrisiken relativ gering gehalten.
Dennoch hat dieser Ansatz zu einem massiven Landkrieg in Europa geführt, der bereits zehntausende Menschenleben gekostet hat und eine existenzielle Bedrohung für Europas Sicherheit und Wohlstand darstellt. Im Nachhinein ist klar, dass diese stabilitätsorientierte Abschreckungshaltung alles andere als ideal war.
Diese Überlegungen müssen auch auf die Zukunft der Ukraine angewandt werden. Eine stabile ukrainische Abschreckungsposition ist bedeutungslos, wenn sie ihren Hauptzweck nicht erreicht: die Abschreckung künftiger russischer Aggressionen.
Stabilität kann daher nicht als Selbstzweck betrachtet werden. Das bedeutet nicht, dass die Ukraine in eine Schockstarre gedrängt werden sollte, aber die richtige Lösung liegt eindeutig irgendwo dazwischen. Vorgeschlagene Abschreckungsstrategien, die dezidiert für Stabilität auf Kosten anderer Faktoren plädieren, sind konzeptionell zu eindimensional, um dieser Notwendigkeit gerecht zu werden, und wahrscheinlich nicht hilfreich. Wie Thomas Schelling berühmt und richtig argumentiert hat: Auch in der Instabilität liegt eine Stabilität.
Autor: Fabian Hoffmann ist Doktorand am Oslo Nuclear Project an der Universität Oslo. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Verteidigungspolitik, Flugkörpertechnologie und Nuklearstrategie. Der Beitrag erschien erstmalig am 8.01.2025 in englischer Sprache im „Missile Matters“ Newsletter auf Substack.