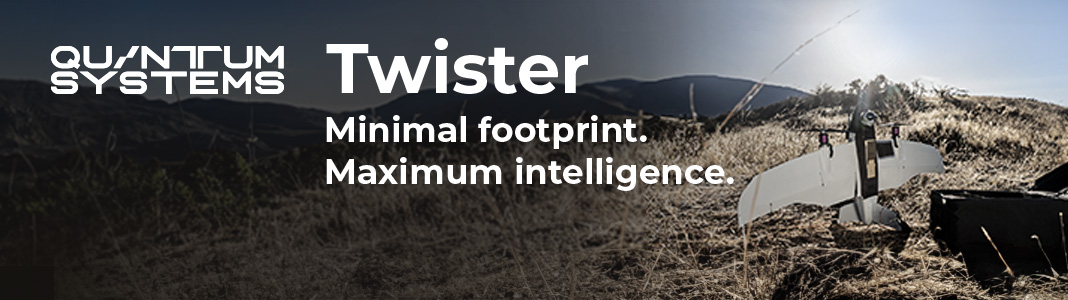Das Software- und Verteidigungsunternehmen Helsing hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 18 Monaten eine mit Künstlicher Intelligenz (KI) versehende unbemannte Plattform zur Detektion von Bedrohungen unter der Wasseroberfläche entwickelt. Dabei wird eine KI-Software mit der Bezeichnung Lura eingesetzt, die von Unterwassermikrofonen, sogenannten Hydrophonen, gesammelte Informationen verarbeitet. Den Angaben von Helsing zufolge kann Lura mit besonders hoher Empfindlichkeit und Genauigkeit die akustischen Signaturen von Schiffen und U-Booten klassifizieren und orten.
Für den Start hat das Unternehmen gleich die Hardware für das Produkt mitentwickelt: Integriert ist Lura nämlich auf einen etwa 60 Kilogramm schweren und 195 cm langen Unterwasser-Gleiter aus gepresstem Kunststoff mit der Bezeichnung SG-1 Fathom, der sich durch das Umpumpen von Luft innerhalb des Bootsköpers in einer Art Sinuslinie mit ein bis zwei Knoten Geschwindigkeit im Meer fortbewegt. Der dafür benötigte Strom wird aus einer Lithium-Ionen-Batterie geliefert, die auch die vier Hydrophone sowie die CPU für die KI mit Energie speist. Das Ganze sei auf hohe Energieeffizienz ausgelegt, was einen Dauerbetrieb von sechs bis acht Wochen am Stück zulasse, erläuterte Simon Vogt, Associate Director, Programmes bei Helsing, in einer Präsentation vor Journalisten.
Nach Angabe von Helsing kann das Lura-Modell akustische Signaturen 10-mal leiser als andere KI-Modelle erkennen, zwischen bestimmten Schiffen derselben Klasse unterscheiden, und das bis zu 40-mal schneller als menschliche Bediener.
Mehrere Vergleichsstudien hätten ergeben, dass die KI überdies deutlich schneller ein Signal verarbeite. Während ein Operateur 25 Minuten benötige, schaffe Lura dies in weniger als drei Minuten bei einer Genauigkeit von 90 Prozent, betonte Vogt.
Der Vorteil eines Gliders als Trägermittel besteht darin, dass dieser extrem leise ist, weil er keinen Propeller als Antrieb nutzt. „Er soll nur horchen“, sagte der Helsing-Manager. Außerdem ist die Antriebsmethode sehr ressourcenschonend, was die langen Stehzeiten auf See ermöglicht.
Gebaut wird der unbemannte Unterwassergleiter von der australischen Firma Blue Ocean, die laut Vogt bis zu 30 Jahre Erfahrung mit den solchen Drohnen hat. Ursprünglich war ihre Aufgabe die Kartierung von Seegebieten, wobei Tauchtiefen von bis zu 2.000 Metern erreicht werden. Dabei sind die Gleiter so klein, dass sie keine Gefahr oder Hindernis für die zivile Schifffahrt darstellen.

| Technische Daten des SG-1 Fathom nach Angaben des Herstellers | |
| Länge | 195 cm |
| Durchmesser | 28 cm |
| Gewicht | 60 kg |
| Geschwindigkeit | 1-2 kts |
| Stehzeit | Bis zu 3 Monate |
Ordnet Lura ein eingegangenes Signal einem feindlichen Objekt zu, taucht der Gleiter auf und stellt eine Satellitenverbindung her, über die die Information an das Lagezentrum weitergegeben wird. Über den Satellitenlink kann das unbemannte Wasserfahrzeug auch Anweisungen erhalten, etwa die Aufforderung zur Kursänderung. Von der Detektion bis zum Report an Land soll dies in der Ostsee in weniger als drei Minuten möglich sein. Im Lagezentrum wird dann entschieden, wie gegen die entdeckte Unterwasserbedrohung vorgegangen wird, etwa durch die Entsendung von Schiffen oder U-Jagd-Flugzeugen.
Helsing zufolge ist vorgesehen, die Gleiter in großer Zahl von 50 bis hin zu mehreren Hundert Exemplaren einzusetzen, um Meeresengen oder -gebiete zu überwachen. Dabei können die unbemannten Unterwasserfahrzeuge in Ketten oder Schwärmen eingesetzt werden. Es solle ein „permanentes kognitives Unterwassernetz“ entstehen, sagte Vogt. Dabei werden 50 Gleiter benötigt, um eine Strecke von 200 Kilometern abzudecken.
Hat der Glider nach mehreren Wochen seine Energie weitgehend verbraucht, wird er an Land oder auf einem Schiff mit einer neuen Batterie bestückt, gereinigt, die Daten ausgelesen und die KI mit neuen Updates gefüttert, bevor er wieder auf die Reise geschickt wird. Damit soll erreicht werden, dass die Software jeweils den neuesten Stand aufweist. So können beispielsweise die Geräuschprofile von neu klassifizierten U-Booten oder Torpedos eingepflegt werden.
Helsing liefert dabei das Software-Grundmodell von Lura. Eine Kunde kann dann seine eigenen akustischen Daten einpflegen, ohne dass Infos zurück an Helsing gehen. Damit wird sichergestellt, dass die oftmals als geheim eingestuften Informationen nicht nach außen gelangen.
Nach Einschätzung von Sandra Jung, Director Programmes bei Helsing, könnte es sich bei dem Konzept um einen „Game Changer“ handeln. Das Unternehmen bereitet nach eigenen Angaben bereits die Massenproduktion für das Produkt vor, das den Angaben zufolge einen sogenannten Technologie-Reifegrad von 8 bis 9 haben soll. Wie es heißt, wird eine Fertigungsstätte in Großbritannien aufgebaut, eine zweite soll in Kontinentaleuropa folgen, wobei der Standort wohl noch nicht final ausgewählt ist. Es gebe bereits genug „verbindliches Interesse“, das den Produktionsaufbau rechtfertige, sagte Vogt. Offenbar ist das Unternehmen mit der WTD 71, der deutschen Marine und Marinestreitkräften an der Ostflanke der NATO in Gesprächen.
Die Lieferkette werde im Augenblick so ausgerichtet, dass auf ein Sourcing in China verzichtet werden könne, so Vogt. Auch seien keine Elemente enthalten, die der US-Exportkontrolle gemäß ITAR unterliegen.
Wie oft ein Gleiter auftauchen soll, um Daten zu empfangen oder zu überprüfen, ob das inerte Navigationssystem die Unterwasserdrohne auf dem richtigen Kurs hält, kann programmiert werden und variiert typischerweise zwischen einer Stunde und einem Tag.
Bei Bedarf kann sich der Gleiter auch auf dem Meeresgrund ablegen, was in der Ostsee aufgrund der dortigen Verschlammung jedoch nicht ratsam ist. Getestet wird das System gegenwärtig in der Ostsee und im Atlantik mit Unterstützung der Marine.
Ab Juni sollen rund 20 Prototypen im Wasser sein und Daten sammeln. Im Sechswochenrhytmus soll dann jeweils ein neues Los dazukommen. Das Kommunikationssystem ist laut Hersteller Datenlink-agnostisch und könnte im Back-up in der Ostsee auch mit 5G oder mit HF-Funk ausgestattet werden.
Die erwartete Lebensdauer eines Gleiters bezifferte Jung auf 2,5 bis 3 Jahre. Sollte jetzt bestellt werden, können laut Helsing 100 Systeme bis Ende des 3. Quartals geliefert werden. Das Unternehmen sieht sich hier gegenüber potenziellen Konkurrenten im Vorteil, weil die schnelle Skalierung der Produktion möglich sei, während andere Player im Manufaktur-Betrieb arbeiteten. Dabei liegen Helsing zufolge die Kosten bei einem Bruchteil anderer Anbieter. Bei der verbauten Hardware handele es sich denn auch um „Commercial off-the-Shelf“-Produkte.
Lars Hoffmann